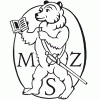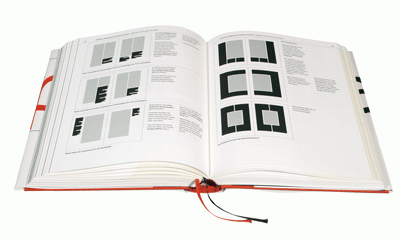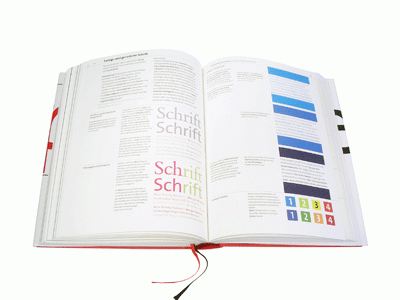Die Liebe zum Detail—Friedrich Forssman und Ralf de Jong legen ein Lexikon der Mikrotypographie vor
Die Schriftsetzerei mit der Bleiletter ist fast ausgestorben. Unter allen Handwerken war ihre Geschichte kurz, sie begann um 1440 mit Gutenbergs Erfindung und lief aus seit 1970 mit der Einführung des Fotosatzes. In den achtziger Jahren wurden die letzten Bleisetzer ausgebildet, die wenigsten von ihnen haben in diesem Beruf jemals praktiziert. Sie wechselten in die Verlagsbranche, wurden Hersteller und Entwerfer, nicht wenige von ihnen auch Autoren. Weil der Beruf des Bleisetzers eine relativ kurze Geschichte hat und vielleicht auch, weil er sich durch Nähe zum künstlerischen Handwerk von anderen Berufen abhob – man sprach vor einhundert Jahren vom „Stehkragenproletariat“ –, kam es nicht dazu, daß selbst allgemeine Regeln des Satzes einmal niedergeschrieben wurden. Standardwerke zur Berufsausbildung hat es nie gegeben, man reichte ein umfangreiches Regelwerk durch die Reihen der Generationen, das sich im übrigen erst spät bildete, sich aber mit einer dem Duden vergleichbaren Verbindlichkeit in Verlagen und Druckereien durchsetzte. Seltsam, daß erst jetzt, da die Handarbeit mit der Bleiletter verschwindet, der Tradition soviel Bedeutung beigemessen wird. Aber das ist unbedingt hilfreich für den Leser, denn nur wenn sich die typographische Kunst in einem Rahmen bewegt, bleiben Druckwerke für viele Generationen leicht lesbar. Die Buchkunst gründet überhaupt auf Tradition, ohne Spezialkenntnisse kann der Leser einen zweitausend Jahre alten Buchstaben nicht von einer neuen Variante unterscheiden.
Die Bleisetzer, die „Gehilfen“, wie die Gesellen der „Schwarzen Kunst“ heißen, die „Schweizerdegen“, die sowohl entwerfen als auch setzen und drucken können, und die Meister, sie alle, die sich als die Jünger Gutenbergs betrachten, scheinen sich zu einem starken Rigorismus veranlaßt zu sehen, wenn es darum geht, die Geschichte des Handwerkes zu bewahren. Treffen sie zufällig einmal aufeinander, erkennen sie sich sofort am Vokabular, oft verachten sie die neue Technik. Sie werfen sich die Begriffe ihrer alten Fachsprache wie Parolen zu. Und wie schön diese Wörter klingen! Allein die Liste der Schriftgrade, die der alte Setzer nicht in Ziffern und Maßeinheiten angibt, sondern ein Dutzend Wörter dafür benutzt, die außerdem noch variiert werden, beispielsweise: Nonpareille, Korpus, Cicero, Tertia, Doppeltertia. Alle weisen sie in die Geschichte der Bildung. Der Schriftgrad „Text“ geht auf die von Gutenberg für die 42zeilige Bibel eingesetzten Lettern zurück.
Auch technische Details verraten die Herkunft. Will ein Schweizerdegen einen Zeilenzwischenraum vergrößert wissen, wie gibt er die Stärke des dünnsten Bleimaterials an? Er sagt nicht „ein Punkt“, womit er jenen typographischen Punkt meinen würde, der um 1785 von François-Ambroise Didot und seinem Sohn Firmin auf der Grundlage des „Pied de roi“ bestimmt wurde – das metrische System war noch nicht eingeführt –, sondern er benutzt ein von deutschen Schriftgießern um dieselbe Zeit begründetes Konkordanzsystem. Der Begriff „Konkordanz“ verweist auf seine mittelalterlich-lateinische Herkunft: In Bibeldrucken und Klassikerausgaben stehen am Rand „concordantia“ genannte Hinweise auf Textübereinstimmungen, und von der Breite dieser seitlich anzufügenden Marginalien abgeleitet, wurde der Begriff Konkordanz langsam, im Lauf von Jahrhunderten, in eine Längenbezeichnung überführt, die man mit dem typographischen Maßsystem auf vier Cicero (eine Cicero entspricht zwölf Punkt) festlegte. Von der Konkordanz ausgehend schufen die deutschen Schriftgießer Grade, die sie nach Viertelpetit abstuften. Eine Petit sind acht Didot-Punkt. Die ersten Schriftgrade gehen allesamt in Konkordanzen auf. Ist es nicht ein bestechend elegantes System? Drei Viertelpetit entsprechen einer Nonpareille (6 Punkt). 24 Nonpareille gehen auf in drei Konkordanz. Ebenso gehen 24 Petit (8 Punkt) in vier Konkordanz auf, 24 Korpus (10 Punkt) in fünf Konkordanz, 24 Cicero (12 Punkt) ergeben sechs Konkordanz und so fort. Was also verlangt der Schweizerdegen vom Gehilfen, wenn er einen Zeilenabstand, eine sogenannte Reglette, in der Stärke eines typographischen Punktes (0,376 mm) haben will? „Laß mal 'ne Achtel rüberwachsen!“ ruft er. Auf dieser Mischung von Tradition und Mathematik gründet die alte typographische Sprache, ohne daß es bisher ein Wörterbuch dafür gab. Der traditionelle Schriftsetzer erlernte das Vokabular meist erst nach seiner offiziellen Lehrzeit von älteren Kollegen, denen es auch schon mündlich überliefert worden war. Er übersetzte das Einmaleins aus Zahlen in altertümliche Wörter; er mußte sich gar nicht bewußt machen, daß zwölf Konkordanz 576 Punkt sind, weil es sich für ihn um 48 Cicero-Zeilen handelte. Oder, präziser gesagt, 48 Korpus-Zeilen, mit Viertelpetit durchschossen. Lange, unübersichtliche Zahlen wurden von den Gutenbergjüngern nie benötigt, dafür konnten sie Kopfrechnen.
Nun ahnt man wohl, warum ein Wörterbuch auf mehr als 370 bebilderte Seiten kommen muß, will es das Verständnis der alten Handwerkersprache ermöglichen und die alten Regeln verständlich machen. Dabei sind seine Autoren nicht einmal ins historische Detail gegangen. Dies hätte den Rahmen gesprengt. Das französische typografische Maßsystem des Pariser Schriftgießers Pierre Simon Fournier aus dem Jahr 1737 war gewiß nicht, wie in diesem Buch en passant bemerkt, das erste. Von Fournier stammt allerdings das Duodezimalsystem, in dem er das von ihm als „Prototype“ bezeichnete Grundmaß Cicero in Zwölftel teilte, die er „Point typographique“ nannte. In einem Buchdrucker-Handbuch von 1683 erwähnt der Engländer Joseph Moxon beispielsweise das System der englischen Drucker, welche ihr Landmaß, den Fuß, in Grade aufteilten und dabei schon die bis heute dem historisch orientierten Typographen vertrauten Wörter wie Pearl, Nonparel, Brevir, Great-Canon und so weiter benutzten.
Friedrich Forssman (Jahrgang 1965) und Ralf de Jong (1973 geboren), also keine alten Bleisetzer, sondern junge Computerfüchse, haben mit ihrem Buch, das sie bescheiden ein „Nachschlagewerk“ nennen, eine einladende Brücke zwischen der Vergangenheit eines das Wissen verbreitenden Handwerkes und der Gegenwart und Zukunft des gedruckten Wortes geschlagen. Daß dieses Werk bereits im ersten Anlauf so vorzüglich geraten ist, auch wenn man Einzelheiten wird nacharbeiten müssen, ist einem bewundernswerten Fleiß und einer phantastisch anmutenden Liebe zum Detail zu verdanken. Alle Grundlagen für den Schriftsatz werden dargelegt; jedes Satzzeichen wird erschöpfend behandelt; außerdem kommen Fremdsprachensatz, Umgang mit Fußnoten und Marginalien zur Sprache; das Inhaltsverzeichnis verweist auf alle typographischen Hervorhebungen, Einsatz von Initialen und typographischem Schmuck, Blinden- und Tastschrift und Notensatz. Die reichhaltigen Angaben für den Satz am Computer werden im Internet auf der Seite des Verlages (www.typografie.de) aktualisiert. Buchautoren erhalten Hinweise, wie sie ohne großen Aufwand Manuskripte und Dateien erstellen können, die den Typographen im Verlag nicht in Verzweiflung über übermässig eingesetzte Tabulatoren und Sonderzeichen stürzen lassen. Kurz und gut: dieses Buch ist eine Fibel. Wer daraus lernt und sich ihrer Angaben bedient und versteht, welche Handwerkskunst, wieviel Überlieferung und alte Zuneigung zum Detail in der sogenannten „Mikrotypographie“ steckt, wird sich mit der nötigen Demut, mit Vorsicht und letztlich erfolgreicher dem Entwurf, der „Makrotypographie“ nähern. Dem Gesicht unserer Buch- und Zeitungsseiten wie auch Rundschreiben, Briefbogen und Visitenkarten wird das so gut bekommen wie eine Anti-Aging-Kur, denn nichts hilft so gut gegen das Altern wie die lebendige Verbindung zwischen den Zeiten.
MARTIN Z. SCHRÖDER
Untertitel: Nachschlagewerk für alle Fragen zu Schrift und Satz
Autor(en): Friedrich Forssman, Ralf der Jong
veröffentlicht: 2002
Verlag: Verlag Hermann Schmidt Mainz
Sprache: deutsch
ISBN: 978-3874396424
-
 2
2